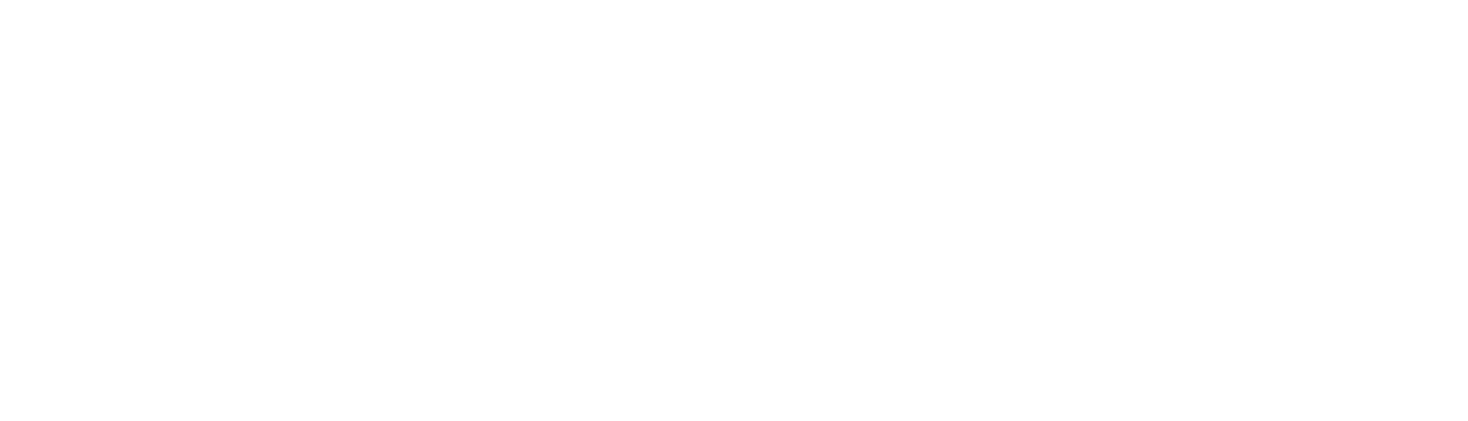Das Schulprogramm der Albert-Schweitzer-Schule
Das gesamte Schulprogramm können Sie als PDF-Datei in Kürze hier herunterladen.
LEITBILD
Die Albert-Schweitzer-Schule (ASS) ist ein Gymnasium der Stadt Offenbach am Main. Mit 1500 Schülerinnen und Schülern und 130 Lehrerinnen und Lehrern aus 60 Nationen spiegelt die ASS die Vielgestaltigkeit der Offenbacher Stadtkultur wider. Die ASS fördert die Integration aller Mitglieder der Schulgemeinde in die Gesellschaft, indem sie die individuelle und kulturelle Vielfalt als Reichtum anerkennt. Basis hierfür ist die Vermittlung von Mut zur Selbständigkeit, von wechselseitigem Respekt und der Bereitschaft zur Übernahme sozialer Verantwortung.
Diese Zielsetzung entspricht auch den Ideen unseres Namensgebers Albert Schweitzer, wie sie sich in seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben ausdrücken:
„Wahrhaft ethisch ist der Mensch nur, wenn er der Nötigung gehorcht, allem Leben, dem er beistehen kann, zu helfen, und sich scheut, irgendetwas Lebendigem Schaden zuzufügen.“[1] „Als gut gilt ihm, Leben erhalten, Leben fördern, entwickelbares Leben auf seinen höchsten Wert bringen. Als böse: Leben vernichten, Leben schädigen, entwickelbares Leben niederhalten.“[2]
Ausgehend von diesen Gedanken ist es der Anspruch der ASS, eine Schulkultur zu leben, die sowohl die individuelle Entwicklung der Schülerinnen und Schüler fördert als auch einen gemeinsamen Lehr- und Lernort schafft, der geprägt ist von Anerkennung, Rücksichtnahme und gegenseitigem Vertrauen der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Lehrenden.
Als Mitglied des weltweiten Netzwerkes der UNESCO-Projektschulen sind die Achtung der Menschenrechte und die Förderung demokratischer Werthaltungen ein besonderes Anliegen unserer schulischen Arbeit, was auch im Wortlaut unserer Erziehungsvereinbarung zum Ausdruck kommt. Gleichzeitig sollen den Schülerinnen und Schülern durch einen anspruchsvollen, leistungsorientierten Unterricht auf hohem fachlichem Niveau Kompetenzen vermittelt werden, die sie für ihren späteren Berufs- und Lebensweg nutzen können.
UNESCO
Die Albert-Schweitzer-Schule ist seit 1991 anerkannte UNESCO-Projektschule. Damit verpflichtet sich die Schulgemeinde, das demokratische Verständnis zu fördern. Über die Wahl von zwei UNESCO-Delegierten je Klasse wird ein schulisches UNESCO-Parlament gebildet, welches die UNESCO-Arbeit der ASS mitgestaltet. Diese orientiert sich an den Zielen und Leitlinien der UNESCO-Projektschulen. Im Rahmen der Erziehung zu Toleranz und gegenseitigem Respekt bilden wir Schülerinnen und Schüler zu Konfliktlösern und digitalen Helden aus, die bei Streitfällen innerhalb der Schülerschaft – auch in sozialen Medien – vermitteln und zu einer friedlichen Lösung beitragen. Um diese Friedensorientierung sichtbar zu machen, hat die UNESCO-AG 2021 einen Friedenspfahl auf dem Schulhof errichtet, der dazu aufrufen soll, sich zukünftig für den Frieden bei uns und in der Welt stark zu machen. 2014 wurde die ASS zudem Teil des bundesweiten Netzwerkes Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und einigte sich in einer Selbstverpflichtung mehrheitlich darauf, aktiv gegen Rassismus, Mobbing und Diskriminierung an der Schule vorzugehen. Zusätzlich haben wir an der ASS seit 2021 eine QU.I.P.-AG (Queer, Interested and Proud), die sich dafür stark macht, dass alle Menschen an dieser Schule ihre Sexualität und Geschlechteridentität angstfrei zeigen und leben können. Zur Förderung einer demokratischen Kultur nimmt die ASS mit 4500 weiteren Schulen an der bundesweiten Initiative Juniorwahl regelmäßig teil, die „das Erleben und Erlernen von Demokratie ermöglichen soll“.[3]
Im Sprachpatenprojekt unterstützen Schülerinnen und Schüler der ASS Kindergärten bei der frühzeitigen Vermittlung der deutschen Sprache. In verschiedenen Exkursionen und Veranstaltungen fördert die ASS zudem die Menschenrechtsbildung und das interkulturelle Verständnis. In einer jährlich wiederkehrenden Woche des interkulturellen Dialoges besuchen Schülerinnen und Schüler der E-Phase verschiedene religiöse Gemeinden in Offenbach und laden Experten zu einem gemeinsamen Gespräch in die Schule ein. Ebenfalls jährlich findet eine Studienreise zur KZ-Gedenkstätte Dachau statt, wo sich interessierte Schülerinnen und Schüler intensiv mit der Verfolgung von Menschen durch das nationalsozialistische Regime auseinandersetzen. In der Q-Phase reisen Schülerinnen und Schüler des Spanischunterrichts nach Barcelona und kommen dort in Kontakt mit Überlebenden der Franco-Diktatur. Die Schulgemeinde der ASS unterstützt auch Bedürftige an anderen Orten in der Welt. Dazu führen die Schüler Sponsorenläufe, Verkaufsbasare und Feste durch, deren Erlöse sie weitergeben. Die Bemühungen um materielle Hilfe kommen aber auch Bedürftigen in Offenbach zu Gute, für die wir jährlich Spendenaktionen durchführen.
MINT
Die Abkürzung MINT steht für Mathematik – Informatik – Naturwissenschaften – Technik. Bereits 2012 wurde die ASS als mintfreundliche Schule ausgezeichnet. Seit Juli 2017 sind wir Mitglied des nationalen Excellence-Schulnetzwerks MINT-EC. MINT-EC-Schulen erfüllen einen einheitlichen Kriterienkatalog, der einen Schwerpunkt auf die MINT-Bildung erkennen lässt. Hierzu gehört u.a. die Teilnahme an Wettbewerben und die lokale oder überregionale Vernetzung mit Partnern aus der Wirtschaft. Insbesondere bietet die ASS verstärkt MINT-Praktika an, mit denen die Schülerinnen und Schüler lernen, ihre im Unterricht erworbenen naturwissenschaftlichen Kenntnisse auch an außerschulischen Lernorten umsetzen zu können. In einer MINT-Sprechstunde werden zudem Möglichkeiten zur Weiterbildung im MINT-Bereich aufgezeigt und dazu passende Berufsperspektiven entwickelt.
Die ASS nimmt seit Jahren erfolgreich an folgenden Wettbewerben im MINT-Bereich teil:
- Jugend forscht
- Chemie – die stimmt
- Internationale Chemie-Olympiade (IChO)
- Internationale Mathematik-Olympiade (IMO)
- Känguru-Wettbewerb in Mathematik
- Internationaler Mathematik Team Wettbewerb Bolyai
- INFORMATIK-BIBER
Darüber hinaus wurde die ASS 2013 in das bundesweite Netzwerk der Junior-Ingenieur-Akademien (JIA) der Deutschen Telekom-Stiftung aufgenommen. Im Rahmen eines Wahlunterrichts zum Thema Robotik richtet die JIA an der ASS jährlich den
Regionalentscheid der World Robot Olympiad (WRO) aus, bei der unsere Schule schon mehrfach Preise gewonnen hat. In Kooperation sowohl mit diversen Unternehmen der Rhein-Main-Region als auch mit der Universität und der Fachhochschule der Stadt Frankfurt a.M. ermöglichen wir unseren Schülerinnen und Schülern Exkursionen und außerschulische Experimentierangebote im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. In der NaWi-Klasse ab der Jahrgangsstufe 5 wird in einer zusätzlichen Stunde Experimentalunterricht von Beginn an der Grundstein für den MINT-Schwerpunkt der ASS gelegt.
SPORT
Als Profilschule für Sporttalente ist die ASS angeschlossen an das regionale Talentzentrum an der Carl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt a.M. Schülerinnen und Schülern wird die Möglichkeit gegeben, eine Sportklasse zu besuchen. Seit dem Schuljahr 2007 wird je Jahrgang eine Sportklasse für Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 eingerichtet.
Die Sportklasse ist eine Schwerpunktklasse, in die sportlich begabte Mädchen und Jungen mit leistungssportlicher Orientierung aufgenommen werden. Sie erhalten eine besondere pädagogische Unterstützung in der Schule, mit der sie ihre höhere Belastung durch intensiv und regelmäßig betriebenen Sport besser auffangen können. Zu ihrer sportlichen Förderung ist in den Jahrgangstufen 5 bis 8 ein Training am Vormittag in den Stundenplan der Sportklasse integriert. Um die Teilnahme an Turnieren und Wettkämpfen an Wochenenden zu ermöglichen, wird diese bei der Terminierung von Hausaufgaben und Klassenarbeiten berücksichtigt.
In Zusammenarbeit mit den Offenbacher Vereinen unterhält die ASS zusätzlich Talentfördergruppen für Basketball, Fechten, Rudern, Schwimmen und Tennis. Schülerinnen und Schüler der ASS nehmen regelmäßig erfolgreich an Stadt-, Regional- und Landesentscheiden des Bundeswettbewerbes Jugend trainiert für Olympia teil. Seit 2023 sind wir eine von 130 Bikeschools in Hessen, mit dem Ziel, die allgemeine Radfahrkompetenz wieder zu stärken, ein verkehrssicheres Fortbewegen zu gewährleisten und den Anteil des Radfahrens am öffentlichen Verkehr im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit kontinuierlich zu steigern.
SPRACHEN
Der Fremdsprachenunterricht beginnt in der 5. Klasse mit dem Fach Englisch. Ab der 7. Klasse kann Spanisch, Französisch oder Latein als 2. Fremdsprache gewählt werden. In den Klassen 9 und 10 wird zusätzlich Italienisch als Wahlunterricht angeboten. In der E-Phase gibt es für Schülerinnen und Schüler, die auf die ASS von anderen Schulen gewechselt haben, einen Anfängerunterricht im Fach Spanisch, der als zweite Fremdsprache bis zum Abitur weitergeführt wird.
In den Jahrgangsstufen 9 und 10 kann zusätzlich Geschichte als englischsprachiges Sachfach im Wahlunterricht belegt werden. In der E-Phase ist es darüber hinaus möglich, statt deutschsprachigen Geschichtsunterricht zu besuchen, das Fach History zu belegen, in dem der Geschichtsunterricht auf Englisch erteilt wird. Schülerinnen und Schüler, die dieses Fach durchgehend bis zum Ende der Q-Phase belegen, haben auch die Option, eine Abiturprüfung in diesem Fach abzulegen.
In den Fächern Französisch und Spanisch können interessierte Schülerinnen und Schüler an externen Sprachprüfungen teilnehmen. Sie werden an der ASS auf den Einzel- oder Gruppenwettbewerb des Bundeswettbewerbs für Fremdsprachen (Französisch und Spanisch) sowie DELF-Sprachprüfungen des Institut Français (Französisch) bzw. das DELE-Diplom des Instituto Cervantes (Spanisch) vorbereitet. Es handelt sich hierbei um international anerkannte Zertifikate für Französisch bzw. Spanisch als Fremdsprache, die die Kompetenzniveaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) bescheinigen. Sie werden vom französischen Ministerium für Bildung, Hochschulen und Forschung ausgestellt bzw. im Namen des spanischen Ministeriums für Erziehung und Wissenschaft vergeben.
Zur Förderung der interkulturellen Erziehung und der Sprachkenntnisse der Schülerschaft wurde im Jahre 2006 das Projekt Rincón Cultural gegründet. Im Rahmen von Rincón Cultural finden Vorträge, Diskussionen, Klassenprojekte und Autorenlesungen nationaler und internationaler Ausrichtung statt, an denen Schülerinnen und Schüler der ASS teilnehmen. Die Schülerinnen und Schüler, die sich schon in einem Land mit Spanisch als Landessprache aufgehalten haben, geben anhand von Vorträgen und medialen Präsentationen ihre Erfahrungen und Ansichten an andere weiter.
FAHRTEN
Die ASS bietet ihren Schülerinnen und Schülern in mehreren jahrgangsstufen Klassen-, Kurs- und Studienfahrten mit unterschiedlichen Schwerpunkten an.
- In der 6. Klasse eine Klassenfahrt innerhalb Deutschlands
- In der 7. Klasse eine Englandfahrt für ausgewählte Schülerinnen und Schüler
- In der 8.Klasse eine Wanderfahrt mit sportlichem Schwerpunkt für alle
- In der Jahrgangsstufe 10 eine Abschlussfahrt mit der jeweiligen Klasse
- Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 und E im Fach Latein eine Romfahrt
- Für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe im Fach Spanisch alle zwei Jahre ein Schüleraustausch mit der Schule IES San Mateo in Madrid
- Eine Studienfahrt in der Jahrgangsstufe Q3
Darüber hinaus finden zahlreiche Ausflüge und Besuche außerschulischer Lernorte z.B. nach Dachau, Point Alpha, Strasbourg und Dachau statt. In jedem Halbjahr wird zusätzlich ein Wandertag im Klassen- und Tutoriumsverbund durchgeführt.
GANZTAG
Im Morgentreff im Häuschen von 7:15 bis 7:45 Uhr wird den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit gegeben, gemütlich gemeinsam in den Tag zu starten. Nach dem Schulunterricht und dem Mittagessen in der schuleigenen Mensa gibt es an der ASS die Bewegte Pause, in der bis 14 Uhr die Möglichkeit besteht, an Spielgeräten oder mit Ballspielen aktiv die Mittagszeit zu verbringen. In zwei Zeitblöcken von 13:15-14:00 Uhr und von 14:00-14:45 Uhr bietet die ASS den Schülerinnen und Schülern bis zur 8. Klasse kostenfrei eine von Lehrkräften und Oberstufenschülern geleitete Hausaufgabenbetreuung an, die nach Anmeldung besucht werden kann.
Anschließend werden bis 15:30 Uhr in einer breit gefächerten AG-Auswahl, die von Handarbeiten, dem Gestalten der Online-Schülerzeitung und Gesellschaftsspielen bis zu Sport reicht, vielgestaltige gemeinsame Aktivitäten angeboten. Parallel dazu findet von 13:00 – 17:00 Uhr nach vorheriger Anmeldung im Häuschen in Zusammenarbeit mit Creative Change e.V. ein Nachmittagsprogramm statt, das neben einer eigenen Hausaufgabenbetreuung auch Spiel- und Freizeitaktivitäten sowie gemeinsame Ausflüge, z.B. zur Kinder- und Jugendfarm in Offenbach, und Besuche von Kindertagesstätten und Seniorenheimen umfasst.
CAFETERIA und MITTAGESSEN
Im Mensabereich stehen eine Cafeteria und ein Speisesaal mit 100 Plätzen zur Verfügung, der bei Bedarf auf 200 Plätze erweitert werden kann. Pädagogisches Ziel von Cafeteria und Mensa ist es, neben einer gesunden und schmackhaften Verpflegung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer Orte der Kommunikation und des sozialen Lebens der Schule zu bieten. Das Essensangebot orientiert sich an den Vorgaben des Bundesministeriums für Gesundheit und den Richtlinien zur Essensversorgung an Schulen. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben erhalten bedürftige Schüler einen Zuschuss zum Mittagsessensgeld.
MEDIATHEK
Die Mediathek ist als Informations- und Kommunikationszentrum ein wichtiger Bestandteil des Ganztagsprogramms. So finden hier u.a. auch eine Lesetreff-AG und eine Spiele-AG statt. Die Mediathek gliedert sich in drei Bereiche: Leseraum, Gruppenraum und Computer-Arbeitsplätze.
Im Leseraum gibt es Kinder- und Jugendbücher, englische Literatur, Zeitschriften und eine Belletristik-Abteilung mit klassischer und moderner Literatur. An Ort und Stelle können die Schülerinnen und Schüler die Bücher und Zeitschriften anschauen und sich in gemütliche Leseecken zurückziehen, um diese zu lesen. Viele Medien sind auch für 14 Tage ausleihbar und können mit nach Hause genommen werden. Die Mediathek stellt neben Schach auch andere Brett- und Gesellschaftsspiele zur Verfügung, die in der Mediathek in Pausen und Freistunden gespielt werden können.
Der Gruppenraum wird multifunktional genutzt. Hier können zum einen Mitglieder der Schüler- und Lehrerschaft an bereitstehenden Tischen arbeiten, bei Bedarf steht dieser Raum zum anderen auch als Veranstaltungs- oder Präsentationsort zur Verfügung. Hierfür steht eigens ein großes Smartboard bereit.
Im Computerbereich sind zurzeit elf PC-Plätze vorhanden. Die Computer sind mit dem Schulnetzwerk verbunden, so dass eigene Texte abgespeichert und schulweit wieder aufgerufen werden können.
BERATUNG
In wöchentlich von den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen der 5. bis 10. Klasse organisierten und durchgeführten Coachingstunden sollen die Schülerinnen und Schüler intensiver individuell gefördert werden und gleichzeitig auch Zeit zur Verfügung stehen, um in einer geschützten Atmosphäre Sorgen zu äußern, über Probleme zu sprechen und Konflikte zu bearbeiten. Zusätzlich stehen dafür in der Schule auch zwei Schulsozialarbeiterinnen und ein sechsköpfiges Vertrauenslehrerteam zur Verfügung. Für Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Veränderung der Schullaufbahn geboten erscheint oder die einen passenden Einstieg ins Berufsleben suchen, stellt die ASS eine Reihe von Beratungsangeboten zur Verfügung:
- Eine Sprechstunde zur Berufs- und Studienorientierung
- Ein zweitägiges Berufsinformationsseminar in Kooperation mit der IHK Offenbach für die Schülerinnen und Schüler der Q2
- Regelmäßige Sprechstunde eines Mitarbeiters der Agentur für Arbeit an der ASS
- Eine Schullaufbahnberatung
Für die Hauptfächer werden zusätzlich wöchentlich Sprechstunden und unterrichtsbegleitende Förderkurse angeboten.
KONTINGENTSTUNDENTAFEL
Die einzelnen Fächer werden an der ASS je nach Jahrgangsstufe mit folgender Stundenanzahl unterrichtet:
| Jahrgangsstufen/Stundenzahl | Summe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterrichtsfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 bis 10 |
| Deutsch | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 2. Fremdsprache | – | – | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Kunst | 2 | 2 | 1* | – | 2 | 2 | 8 |
| Musik | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | 8 |
| Biologie | 2 | 2 | 1* | – | 2 | 1* | 8 |
| Chemie | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Physik | – | – | 1* | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Erdkunde | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 6 |
| PoWi | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geschichte | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| WU/3. Fremdsprache | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| KL | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
| Coaching | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
*verbindlicher binnendifferenzierter Unterricht
**aus Sozialstrukturindex
*** Dieses Fach wird epochal unterrichtet
[1] Albert Schweitzer: Kultur und Ethik, München 1951, S.240
[2] Albert Schweitzer: Die Ehrfurcht vor dem Leben, München 1966, S.22
[3] https://www.juniorwahl.de/projekt/konzept.html
[Stand:11/2023]